Michael Jordan: Mehr als ein Athlet (III)
Michael Jordan gilt vielen als der beste Basketballer aller Zeiten. Zugleich reicht die Bedeutung des Ausnahmekönners weit über den Spielfeldrand hinaus. In einer Trilogie spüren wir daher der Ikone „MJ“ in ihrer Vielgestaltigkeit nach. Der dritte Teil kreist um den Gegenwind, mit dem sich „His Airness“ konfrontiert sah; und die zweite Luft, die er bekam.
Dritter Teil: Rare Air
Michael Jordan wollte nie ein Heilsbringer sein. Ironischerweise trugen seine Glanzleistungen auf dem Basketballparkett aber maßgeblich dazu bei, dass er mit einer überzogenen Erwartungshaltung und entfachten Massenhysterie konfrontiert wurde. Denn es trieb ihn an, auf dem Feld Dinge tun zu können, „that other people can’t do but want to do and they can do only through you“.
„His Airness“ genoss es, ob seiner Einzigartigkeit bewundert und geachtet zu werden. Auch weil er sich die Begeisterung der Menschen verdient und den Respekt der Fans selbst erspielt hatte. Als sich seine Popularität infolge der Dominanz der Chicago Bulls potenzierte und ein andauerndes Mediengewitter über ihn hereinbrach, musste er lernen, mit immensem Druck umzugehen: „Pressure I didn’t ask for, but was given to me and I’ve been living, living with it.“
Jordan wurde sonach zum Gefangenen seiner eigenen Popularität. Wenn er sich überhaupt einmal in die Öffentlichkeit wagte, wurde er sofort belagert und bedrängt. Nirgends konnte er sich ungehindert bewegen. Immer mehr erschien ihm sein Arbeitsplatz als ein letzter Zufluchtsort, wo er Ruhe und Selbsterfüllung fand. Den Basketball-Court beschrieb „MJ“ als „the most peaceful place I can imagine“.
Dort verspürte er weniger Druck, er konnte befreit aufspielen – und vor allem: niemand behelligte ihn. „Being out there is one of the most private parts of my life“, bekannte Jordan. Das Spiel war für ihn wie eine Meditation, die er genoss und ihm Kraft gab: „Seeing people enjoying themselves and relating to them like I’m enjoying myself.“
Für den kontrollierten Athleten fungierte der Court im wahrsten Sinne des Wortes als ein Spielfeld; dort konnte er sein und sich selbst verwirklichen. Dagegen fand er sich außerhalb der Arena in einer Welt wieder, die um das Phänomen „MJ“ zu kreisen schien, das er selbst miterschaffen hatte. Für den Menschen Michael Jordan erwies sich sein stark eingeschränktes Leben als „a trying situation“, die ihn körperlich und mental auszehrte.
Headwind
Auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit angekommen, erfuhr Jordan Anfang der 1990er Jahre zudem erstmals heftigen Gegenwind. Aufscheinende Charakterschwächen und Fehlleistungen wurden nun öffentlich ausgeleuchtet. Sein Saubermann-Image wurde vor allem durch das „Enthüllungsbuch“ von Sam Smith („The Jordan Rules“, 1991) beschmutzt. „MJ“ fühlte sich von den Medien unfair behandelt, er prangerte dies an – O-Ton: „Don’t knock me off the pedestal that you wanted me to get onto“ – und schwieg.
Während sich „Air“ mit den Bulls im Höhenflug befand, wurden ihm abseits des Parketts also die Flügel gestutzt. Dabei wies die kritische Berichterstattung auch unerwartete rassistische Untertöne und Andeutungen auf; sie ließ das bemäntelte Schwarzsein des „weiß“ gewaschenen Mittelklassehelden (siehe zweiter Teil) durchscheinen. Vorübergehend wurde Jordan zu einem der klischeebeladenen „schwarzen Anderen“ gemacht, die als Reizfiguren des weißen Amerika fungieren. Vielen erschien „MJ“ seinerzeit als undankbar und unverantwortlich, selbstsüchtig und selbstzerstörerisch.
1991 wurde Jordan zunächst für ein unpatriotisches Versäumnis gerügt. US-Präsident George H.W. Bush, der die neuen NBA-Champs im Weißen Haus empfing und ehrte, hätte er durch sein Fernbleiben beleidigt. Stattdessen, so der Vorwurf, habe er lieber egoistisch Ferien gemacht, Golf gespielt und unmoralisch hohe Geldsummen verspielt.
Dass auch afroamerikanische Teamkollegen wie Horace Grant den ungeliebten „POTUS“ nicht durch ihr Erscheinen legitimieren wollten, aber nur Jordan vonseiten der Bulls-Führung eine Sondererlaubnis erhielt, blieb außen vor („I ain’t goin’ to no White House. I didn’t vote for that guy“, soll „MJ“ teamintern verkündet haben).
Hinzu kam ein weiterer persönlich-politischer Affront, als Mitspieler Craig Hodges gegenüber der konservativen US-Regierung im Dashiki für afroamerikanische Interessen eintrat. Im weißen Amerika und in NBA-Führungsetagen machte er sich damit kultürlich keine Freunde (siehe auch zweiter Teil).
Denn im Gegensatz zu Jordan bezog „the controversial, outspoken Brother“ als schwarzer Mann öffentlich Stellung, nahm solidarisch Anteil und äußerte Kritik. Mit seinem couragierten Handeln hielt sich Hodges nicht ans Skript und brach aus der ihm zugeschriebenen Rolle aus.
So waren den gesellschaftspolitischen Äußerungen afroamerikanischer Athleten lange Zeit sehr enge Grenzen gesetzt. Meist wurden erstere umgehend abgemildert, bedauert und rigoros eingehegt – zu Non-Stories gemacht. Sie störten nur das profitable Geschäft und brachten die Ordnung der Dinge unnötig durcheinander. Daher musste Hodges in der Folge erfahren, dass verantwortungsvolle NBA-Spieler keine politische Immunität genossen.
Jordan geriet seinerseits Anfang 1992 wiederum in die Patriotismus-Falle, da er die Olympia-Einladung von Team USA nicht sofort pflichtgemäß annahm. Anschließend setzte er sich harscher Kritik aus, als er gegenüber der NBA und den Olympia-Ausrichtern auf den kommerziellen Rechten am eigenen Abbild beharrte.
Sodann haderte die unterstellt habgierige Nike-Galionsfigur damit, die Bekleidung des offiziellen „Dream Team“-Ausrüsters während der Spiele zu tragen. Auf dem Siegerpodium angekommen, drapierte „MJ“ seine Schulter schließlich mit einer US-Flagge, um so das Logo von Marktkonkurrent Reebok zu verdecken (Charles Barkley und Magic Johnson taten es ihm gleich). „I don’t believe in endorsing my competition. I feel very strongly about loyalty to my own company“, erklärte Jordan daraufhin.
Was in die Diskussion um Jordans Olympia-Teilnahme hingegen kaum Eingang fand, war seine immens hohe Belastung durch die zahlreichen Saison-, Playoff-, Trainings- und Vorbereitungsspiele. Von der legitimen Selbstkontrolle profitabler Persönlichkeitsrechte einmal abgesehen. In jedem Fall war Team Jordan, der Konsum und Kult des Individuums nun maßgebend. Entsprechend fragte LL Cool J später einmal: „You in it for the money, or in it for the love, M.J.? 23 ways to make a pay.“
Nach einem weiteren glanzvollen Meisterschaftsgewinn und dem globalen Erfolg des „Dream Teams“ schien die Kritik zu verstummen. Aber bereits Mitte 1993 – nicht zufällig das Jahr seines ersten Rücktritts mit 30 Jahren – brach ein erneuter Kritiksturm über Jordan herein. Sein Charakter und sein Image als All-American standen wiederum infrage.
Vor allem die „entdeckte“ menschliche Schwäche des Großmeisters, seine Glücksspielsucht, wurde lanciert und sensationsheischend ausgeweidet. „MJ“, der ohnehin als hyperkompetitiver Zocker und unverträglicher Teamkollege galt, erhielt dabei die Rolle des pathologisch unverantwortlichen „schwarzen Anderen“. Es hieß: Er würde sich vor wichtigen Wettkämpfen (die er meist trotzdem dominierte) seiner exzessiven Spiellust hingeben und die Nacht zum Tage machen.
Auch befeuerte Jordans deviantes Verhalten Gerüchte über Spielschulden, Drogenkonsum, Promiskuität und Spekulationen über mögliche kriminelle Verbindungen: Etwa wurde einer seiner Checks, wohl zur Begleichung von Golfschulden, auf einen Mann ausgestellt, der später wegen Geldwäsche verurteilt wurde. Ein anderer Golfkumpel kam 1993 mit einem Buch heraus, in dem er „MJs“ Glücksspielproblem breittrat.
Indes wurde seine Integrität nicht nachhaltig beschädigt. Ein wiederholter Titelgewinn – und damit der eindrucksvolle „Threepeat“ – sowie Jordans freimütige Medienauftritte ließen die Erzählung vom ungehörigen, „schwarzen“ Verhalten verklingen.
Schon im August 1993 wurde die überzeichnete Negativzuschreibung jedoch reaktiviert, als der an James Jordan verübte Raubmord mit der „dunklen Seite“ seines Sohnes, besonders dessen Glücksspielaktivitäten, verknüpft wurde.
Die in den Medien laut gewordenen, haltlosen Mutmaßungen über „MJs“ Mitschuld am tragischen Tod seines engsten Vertrauten ebbten erst mit der Festnahme und Schuldigsprechung zweier Männer ab.
Nun fokussierte die Berichterstattung auf den afroamerikanischen Verurteilten, der das Stereotyp des schwarzen Gewalttäters bediente und öffentlich die Hauptlast zu tragen hatte.
Jordans umgehende Rehabilitierung wurde durch diese gesellschaftlich eingeübte Schuldzuweisung begünstigt. Der Verlust seines Vaters blieb unterdessen eine schmerzvolle Erfahrung, mit der auch der erste Rücktritt korrelierte.
Back to Black
2002, während er sich in Washington als Wizard versuchte, hatte „MJ“ seine letztere größere Image-Krise zu bewältigen – seine „Dankesrede“ zur Aufnahme in die Basketball Hall of Fame (2009) einmal ausgelassen. Denn seine langjährige Ehefrau Juanita Vanoy reichte nicht nur die Scheidung ein (die kostspielige Trennung wurde letztlich 2006 vollzogen) – auch die vielen unsportlichen Fouls, die er als Ehemann begangen hatte, wurden publik gemacht.
Das inszenierte Bild des vorbildhaften Familienmenschen und Werteträgers (siehe zweiter Teil), das seine vermeintlich unkontrollierte „schwarze Sexualität“ eingehegt hatte, war nun hinfällig.
Nicht selten wurde Jordan seither eine Midlife-Crisis attestiert, er als nicht altern wollender „Player“ belächelt. Gleichwohl ist der 57-jährige Lebemann längst wieder glücklich verheiratet und 2014 nochmals Vater von Zwillingen geworden (hinzu kommen drei erwachsene Kinder aus erster Ehe).
Derweil sollte das zeitweilige Wiederaufscheinen von Jordans Schwarzsein nicht einfach als Non-Story abgetan werden. Denn es stellt kultürlich keinen Einzelfall dar. Vielmehr steht es für eine gesellschaftliche Dynamik, der sich afroamerikanische Ikonen und Sporthelden wiederholt ausgesetzt sehen. Prominente Beispiele sind der einst des Doppelmordes angeklagte Crossover-Star O. J. Simpson, ein der Vergewaltigung beschuldigter Kobe Bryant oder der angeblich sexsüchtige Ehebrecher Tiger Woods.
So rufen schwarze Erfolgsathleten im weißen Amerika einerseits Bewunderung, Faszination und „Be Like Mike“-Gefühle hervor. Andererseits stoßen sie auch auf rassistisch aufgeladene Angst und Ressentiments.
Dies gilt besonders dann, wenn sie die Grenzen des – für Afroamerikaner – als akzeptabel angesehenen Verhaltens überschreiten (Achtung: Doppelstandard). Werden weiße Normen und Privilegien infrage gestellt, tritt in der ach so farbenblinden US-Gesellschaft Rassismus mehr oder weniger deutlich zutage. Scheinbar „farblose“ und überlebensgroße Heldenfiguren werden dann postwendend in „gewöhnliche Schwarze“ zurückverwandelt.
Medien- und Zuschauerlieblinge wie O. J., Kobe und Tiger galten etwa (zeitweise) als charakterlose, gewalttätige und hypersexuelle schwarze Männer. „MJ“ kriminalisierte man als „schwarzen Gambler“. „Just another black guy“, lautete überspitzt formuliert der medial aufgedrückte Stempel.
Gewiss, die Gefangenschaft im Negativ-Stereotyp kann eine flüchtige sein – „MJ“, Kobe und Tiger haben dies gezeigt. Erneute Heldentaten, ein wenig Reue oder ein Sich-Neuerfinden (die „Schwarze Mamba“ lässt grüßen) können im weißen Amerika Image-Wunder bewirken und „Fehler“ schnell vergessen machen.

Auch in der NBA drohten bei Regelverletzungen unter einem strengen „Oberkommissar“ wie David Stern (1984-2014) Sanktionen: von zeitweisem Liebesentzug, öffentlicher Maßreglung und Diffamierung, über Geldstrafen, Spielsperren bis hin zu verkürzten Karrieren. Entertainer-Athleten, die aus der Rolle fielen und nicht den Eindruck dankbarer Anständigkeit erweckten, wurden medial abgestraft und zu dämonisierten „schwarzen Anderen“ gemacht. Etwa zu „Thugs“ und „Jail Blazers“.
Vor allem in den Nullerjahren, der Zeit nach Jordan, hatte die Liga eine größere Image-Krise zu bewältigen – die mitnichten die erste dieser Art beschreibt (gleich mehr dazu). So war damals von spielerischer wie sozialer Unreife, von zu viel „Hero Ball“ und Hip-Hop die Rede. Eine relative Unbeliebtheit und sinkende Quoten wurden ausgemacht – und auf die Präsenz vermeintlicher „Gangstas“ zurückgeführt. Die unrühmliche Massenschlägerei in Auburn Hills (2004) veranlasste das Ligabüro letztlich dazu, „[a need to] put out the fires“ festzustellen und durchzugreifen.
Der notorische Dresscode, ein erhöhtes NBA-Eintrittsalter und weitere Regulierungen (Ts, Bußgelder, Spielsperren, usw.) folgten, die ein geschäftsbedrohliches Schwarzsein oberflächlich einhegen sollten. Öffentlich sprach Commissioner Stern freilich von der Wiederherstellung verlorener Professionalität.
Anvisiert wurde dabei ein angepasstes, „ungefährliches“ Schwarzsein im Stile von „Prime Jordan“ – das zugleich ein faszinierendes Anderssein darstellt. Schließlich wird solch eine Selbstpräsentation in den USA weithin akzeptiert, gerne konsumiert und mithin gefeiert. Es ist eine Dynamik, die bis heute fortwirkt. Auch wenn die NBA-Stars längst die darstellerische Regie übernommen haben …
1993 fiel Jordan nur für kurze Zeit in Ungnade. Nachsichtig vergab man ihm – er hatte ja ohnehin nichts Strafwürdiges getan. Derweil mag seine damals unerwartete Rücktrittsentscheidung heute kaum noch verwundern. Seinerzeit löste „MJs“ episodischer Basketballruhestand eine Welle nationaler Trauer und Wehmut aus.
Allerorts wurde im Herbst 1993 der Verlust eines All-American beklagt und der sich zurückziehende Großmeister belobigt. Selbst US-Präsident Bill Clinton ließ voller Pathos verlauten: „We may never see another like him again. We will miss him – here and all around America, in every small-town backyard and paved city lot where kids play one-on-one and dream of being like Mike.“
Second Wind
„Mike“ lebte Mitte der 90s seinen eigenen Jugendtraum (und zugleich den seines Vaters): In der unterklassigen Minor League versuchte er sich als Baseballprofi. Seine ehrliche Liebe zum amerikanischen Nationalspiel, sein ehrgeiziges und hingebungsvolles Bemühen, aber relatives Scheitern brachte ihm dabei viele Sympathiepunkte ein.
Im Frühjahr 1995 hieß es dann aber „I’m back“. Mit 32 Jahren kehrte Jordan dem Baseball den Rücken und wendete sich dem Spiel zu, das er so nachhaltig geprägt und dominiert hatte. Der reaktivierte „GOAT“ wollte es aber nicht nur noch einmal wissen, sondern auch die Integrität der NBA wiederherstellen.
„MJ“ erklärte: „I really felt that I wanted to instill some positive things back to the game. You know, there’s a lot of negative things that have been happening to the game.“ Damit sprach er den wahrgenommen Niedergang des Spiels und der Liga an. Dieser wurde (analog zu den Nullerjahren) an der Devianz und Delinquenz einer ungehorsamen Spielergeneration festgemacht.
Afroamerikanische Jungstars wie Derrick Coleman, Isaiah Rider, Latrell Sprewell oder Chris Webber galten als egoistisch, unzuverlässig und genauso wie die Association als zu „schwarz“. Sie besäßen keine Liebe zum Spiel und hätten Jazz-Poesie in Gangsta-Rap verwandelt, hieß es. Zu viel „Street-Cred“ und „Badass-Swag“ lautete die Anklage.
So lief die Suche nach dem „nächsten Jordan“, einem angepassten Überflieger auf Hochtouren. Penny Hardaway, Grant Hill und Harold Miner waren zum Teil bereits durchgefallen, als „MJ“ seine Wiederkehr ankündigte und begründete: „The young guys are not taking care of their responsibilities in terms of maintaining that love for the game, and not let it waste to where’s it’s so business-oriented that the integrity of the game’s going to be at stake.“
Der Wegbereiter der ungeliebten Hip-Hop-Generation kam sonach als Heilsbringer in die Liga zurück.
Sein umjubeltes Comeback beschrieb die Rückkehr an die Spitze; es bedeutete einen erneuten „Threepeat“, weitere Auszeichnungen, eine Rekordbilanz, hysterische Heldenverehrung und für manche die Rettung der NBA. Die 90er Jahre wurden so endgültig zur Dekade der erwiesenen Ikone des Basketballs und seiner Chicago Bulls.
Indes blieb der berühmte „Last Shot“ bekanntlich nicht Jordans letzter Wurf. Sein brennender Ehrgeiz trieb den Basketballmanager und Anteilseigner der Washington Wizards zu einer mäßig erfolgreichen Wiederkehr im Trikot der Hauptstädter (2001-2003).
Als 40-Jähriger, der weniger „Jordanesque“ aufspielte, definierte er sich weiterhin über den Sport. Für den Wettkampf fand der gealterte „Alphabulle“ keinen Ersatz. Er konnte nicht loslassen, bevor seine Knie die Liga-Strapazen nicht länger mitmachten und er auch den letzten seiner jungen Teamkollegen vergrault hatte. Jedoch wollte Jordan das Spiel noch immer mitbestimmen. Auch deswegen kehrte er 2006 als Minderheitseigner und Basketballdirektor seiner Heimatfranchise in Charlotte ins NBA-Geschäft zurück.
Einige kritikreiche, weil nahezu erfolglose Spielzeiten später, löste er 2010 schließlich Robert Johnson – den ersten schwarzen US-Milliardär und Teambesitzer – als Franchiseboss ab. In den großen Sportligen Nordamerikas (mit rund 150 Teams) amtiert „MJ“ seither als einziger afroamerikanischer Mehrheitseigner. Zugleich ist er der erste ehemalige NBA-Profi, der sich ein eigenes NBA-Team leistet.
Dabei sieht sich der Eigner der Hornets gerne als Selfmade-Pionier, der anderen Ehemaligen den Weg bereitet: „It is a road I would love to see other guys follow. Hopefully they will get the opportunity.“
Hoffnung auf Teilhabe und Wandel allein, wird sicher nicht hinreichend sein, um die Phalanx weißer Männer weiter aufzubrechen, die den Board of Governors der NBA bilden (Marc Lasry und Vivek Ranadivé sind neben „MJ“ die einzigen nicht-weißen Mehrheitseigner; hinzu kommen mit Jeanie Buss, Gail Miller, Julianna Hawn Holt und Gayle Benson vier weiße Frauen). Zudem wird Jordan in seiner exponierten Position und gewohnten politischen Zurückhaltung wohl auch in Zukunft primär den farbenblinden Idealismus hochhalten.
Indes wäre es zu kurz gegriffen, den schwarzen Teamboss als unkritischen Selbstverkäufer abzustempeln. Denn über die Jahre hat Jordan zu gesellschaftspolitischen Themen häufiger das Wort ergriffen. Etwa 2014, als er sich mit Nachdruck gegen den damaligen Teambesitzer der L.A. Clippers und (dessen) Rassismus aussprach. Später beklagte er die zunehmende Spaltung sowie den Hass in der US-Gesellschaft und bejahte das Recht politischer Athlet:innen auf freie Meinungsäußerung.
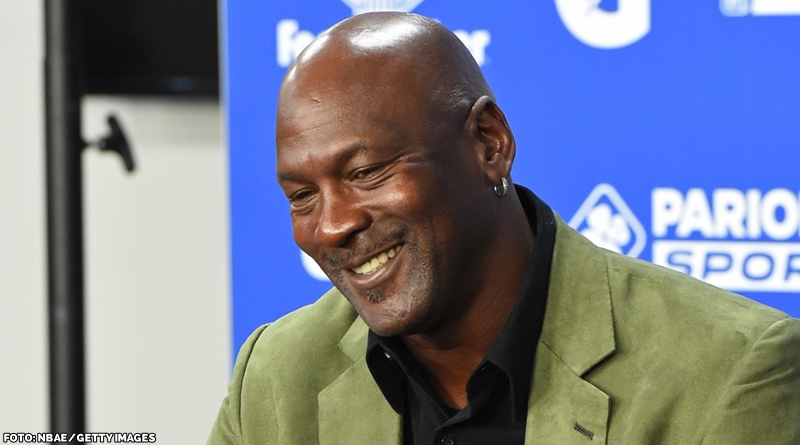
Auch war es zum Überraschen mancher Jordan, der sich im Sommer 2016 als einziger Governor der NBA zur grassierenden Polizeigewalt gegen schwarze Menschen öffentlich äußerte.
Damit nicht genug, der erwiesene Philanthrop griff seinerzeit auch tief in die Tasche. Er spendete zwei Millionen US-Dollar, die ausgleichend an eine Instanz des Polizeiverbandes IACP (die auf verbesserte Gemeindebeziehungen abzielt) und an einen Rechtsbeihilfefond der afroamerikanischen Bürgerrechtsorganisation NAACP gingen. Zudem stiftete er weitere fünf Millionen, die das National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C. begünstigten. „MJ“ zeigte damit die politische Haltung und soziale Verantwortung, die viele lange eingefordert und ihm abgesprochen haben.
Die Rede von Jordans verspätetem gesellschaftspolitischem Engagement ist derweil ein Trugschluss. Gewiss, zu kontroversen Themen bezog der „Herr der Lüfte“ während seiner Hochglanzkarriere image- und markenbewusst nie öffentlich Stellung. Allerdings hat der schwarze CEO Michael Jordan ohne große Statements und symbolische Auftritte stillschweigend Veränderung bewirkt.
So hat er in seinen Geschäftsunternehmungen überproportional Frauen und Minderheiten eingestellt sowie diverse Topmanagement-Teams installiert. Entsprechend weisen „MJs“ Hornets seit Jahren eine der diversesten Führungsriegen im US-Profisport auf (inklusive seines älteren Bruders Ronnie Jordan). Die Jordan Brand, Tochtermarke und Zugpferd von Nike, beschäftigt in leitenden Positionen seit jeher schwarze Menschen und eröffnet ihnen rare sozioökonomische Teilhabe. Auch arbeitet die Jordan Brand seit 2015 in fünf Städten (Chicago, Los Angeles, New York City, Philadelphia und Portland) mit 23 Community-Partnern zusammen und hat über ihr „Wings“-Programm bisher mehr als 225 Student:innen – Tendenz steigend – mit vollständigen akademischen Stipendien ausgestattet. All dies ist kein Zufall, sondern „MJs“ übersehener Beitrag zu gesellschaftlichem Fortschritt.
„It’s Michael Jordan we must recognize as the truest prophet of what might be possible“, schrieb einst der Novellist John Edgar Wideman.
Doch in Anbetracht des gesamtgesellschaftlichen Zustands der USA, der systemischen Ungleichheit und dem unzureichenden Veränderungswillen, muss hier ein hoffnungsvoller Ausblick entfallen. Vielmehr gilt: Michael Jordan war und bleibt eine Ausnahmeerscheinung. Nennen wir ihn „Rare Air“.
Eine erste Version der Jordan-Trilogie ist im März 2015 auf der Plattform 3meter5.de (heute gotnexxt.de) erschienen.



